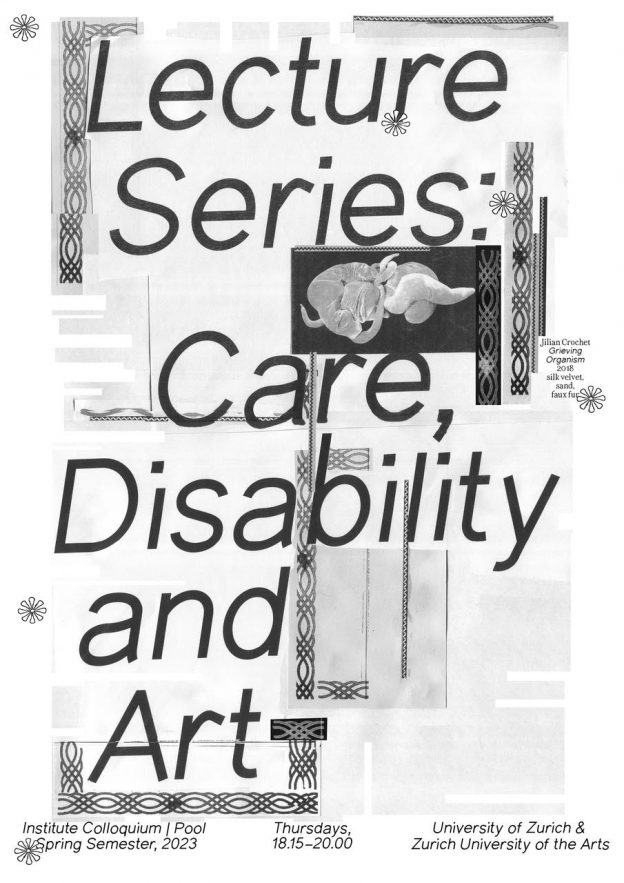Ein eindrucksreiches Wochenende verbrachten Grit und ich dieser Tage auf der Xplore, jenem Festival, das Körper, Kunst und Begierde miteinander verknüpft wie kaum ein anderes. Gleich hinter dem Pförtnerhaus lag der Hof, der Himmel war mit Wolken durchzogen und die Sinne voll leiser Erwartung – ein Geräusch aus Stimmen, Kopfsteinpflaster und sphärischen Tönen
Xplore gibt es seit 2004. Damals, in der Schwelle 7 im Berliner Wedding, war es ein Geheimtipp, kaum mehr als eine verwinkelte Werkstatt für Experimente. Die Tickets waren binnen Minuten ausverkauft. Wir waren 2014 und 2015 dort, bewegten uns zwischen alten Backsteinmauern, lernten fremde Hände kennen, wovon manche mittlerweile Freunde sind. Später, 2019, reisten wir nach Rom, sprachen über Behinderung und Sexualität, über „Touch Me Not“. 2022 folgte der Umzug in die Malzfabrik, ein Industriebau, der nach Getreide roch und Platz bot für mehr Menschen, mehr Laken, mehr Stimmen.
Jetzt also erneut Tempelhof. Das Festival ist gewachsen, größer, vielleicht lauter geworden. Die Malzfabrik zieht mit ihren hohen Fenstern das Licht hinein, aber auch die Fragen: Was geht dabei verloren, wenn Vertrautheit Platz macht für Raum? Wir atmeten tief ein – und gaben uns der nächsten Runde dieser Reise hin.
Xplore
Xplore nennt sich eine Spielwiese für Sexualität, BDSM, Körperarbeit, Tanz und Ritual. Künstlerinnen, Therapeuten und Aktivistinnen führen durch Workshops, Performances und Vorträge; jede Übung ist eine Einladung, den eigenen Körper neu zu betrachten. Manche Angebote wirken fast medizinisch, andere erinnern an Theaterproben oder stille Meditationen. Gemeinsam wollen sie Neugier wecken, Scham lösen, den Blick für Möglichkeiten öffnen.
Das Publikum ist eine bunte Menge aus allen Körperformen, Gendern und Lebenswegen. Man spürt Vertrauen, Freundlichkeit, Klarheit – als hätte jemand die Luft von Vorurteilen gereinigt. Wer hereinkommt, darf seine Lust zeigen, darf Fragen stellen, darf staunen. Darin liegt der Reiz von Xplore: Es schafft einen Raum, in dem Sexualität weder versteckt noch vorgeführt wird, sondern einfach anwesend sein darf, so selbstverständlich wie Atmen.
Wandel
Früher dauerte Xplore drei Tage, jeder für sich. Ich erinnere mich gerne daran, wie ich nackt auf einem Pferd saß oder an einen Workshop über Sterben und Tod. Zwischen den Räumen lagen offen Türen, man konnte sich treiben lassen und begegnete stets etwas Unerwartetem. Vielfalt war das Prinzip.
Heute gibt es zwei Vorbereitungstage und am Sonntag eine lange gemeinsame Play‑Party. Die Codes der Zustimmung werden zuvor geübt, dann verschmelzen die Übungen zu einem einzigen, rhythmischen Strom. Viele erleben darin ein neues Wir‑Gefühl; ich sehe auch, was verloren ging. Die alte Fülle an Stimmen, Themen, Zufällen – sie schrumpft, wenn alles auf einen Höhepunkt zielt.
Freiheit
Sexpositive Räume sind Freiheit. Menschen aller Körper – jung, alt, trainiert, weich, vernarbt – mischen sich, ohne Rangordnung. Niemand urteilt über einvernehmliche Lust. Berührungen, Nacktheit, Intimität geschehen selbstverständlich und sorgfältig zugleich, als gehörten sie zum Grundrauschen des Tages.
Für mich ist das ein Aufatmen. Im Alltag muss ich meine Sexualität oft erklären, mit Statistiken belegen, verteidigen. Hier ist sie einfach da. Mein Rollstuhl bleibt ein Detail; Freundliche Hände fragen, ob sie helfen dürfen, bringen mir Wasser, öffnen Wege. Vertrauen und Neugier halten das Gelände offen, als läge ein stilles Versprechen in der Luft: Du darfst sein, wie du bist, und alles, was dich freut, hat hier Platz.
Begegnungen
Der Workshop „Bad Romance“ gab uns Karten in die Hand: „Stolpere über deine Worte“, „Lobe den Pullover zu lang“, „Verwechsle den Namen“. Wir übten das Unbeholfene wie eine Choreografie, versanken in Peinlichkeiten und lachten, bis uns die Schultern zuckten. Aus der Lächerlichkeit wuchs ein unerwartetes Band; man fühlte, wie Scheu im Gelächter schmolz und Nähe entstand, gerade weil niemand glänzen musste.
Ein anderer Workshop beschäftigte sich mit Transformation. Wir lagen in kleinen Gruppen auf Matten, schlossen die Augen. Eine Person atmete, die anderen legten Hände auf Rücken, Schultern, Stirn. Die Körper wurden zu Resonanzräumen, in denen Atem, Wärme und Herzschlag kreisten. Als wir aufstanden, war etwas verrückt – leiser vielleicht, aber wärmer; fremde Energie ruhte in den Gelenken, und mancher wischte sich Tränen ab, ohne Scheu, weil alles dafür vorgesehen war.
Grenzen
Die Malzfabrik ist schöner als die Schwelle 7, aber weniger barrierefrei. Zwei Treppen hielten mich von einem Nebenraum fern, in dem Körper tanzten und Lachen aufbrandete. Beim Workshop „Bad Romance“ lag ich schließlich auf einer Matte am Rand; freundliche Arme halfen, doch ich blieb Zuschauer. Zugänglichkeit heißt mehr, als anwesend zu sein. Sie heißt teilhaben, das eigene Gewicht in die Szene werfen können.
Schwieriger noch war das Schweigen. Die meisten Übungen verlangten Blickkontakt, Gesten, Atem – kaum Worte. Für mich sind Wörter ein Werkzeug, so unverzichtbar wie die Reifen meines Stuhls. Ohne sie stockte der Kontakt, als fehlte eine Hälfte des Kreises. Schweigen kann ausschließen, so wie Treppen ausschließen. Beide Hindernisse sind gleich hoch, nur anders gebaut.
Seit der Umstellung liegt der Schwerpunkt fast ausschließlich auf Körperlichkeit, Bewegung, Tanz. Früher gab es neben Bondage und Atemarbeit auch Runden über Beziehungen, Konsens, Poly‑Ethik; Worte hatten Gewicht, Gedanken wurden hin‑ und hergereicht wie Schalen mit Wasser. Jetzt pulst der Bass, die Halle schwingt, Arme und Hüften zeichnen Muster in die Luft. Viele lieben das; sie reisen genau dafür an, und auch Grit blüht in den Tänzen auf, ihr Lachen fliegt über den Parkettboden. Doch ich, der mit Sprache glänzt, stehe im Halbdunkel. Mein Körper folgt einem langsameren Takt, meine Worte verhallen, bevor sie beginnen. In einem Raum, der vom Rhythmus lebt, bleibe ich eine leise Randnotiz.
Inklusion
Inklusion beginnt nicht mit Rampen, sondern mit Zeit. Crip Time nennt man sie: genug Raum, damit jeder seinen Rhythmus findet, ohne Uhr im Nacken. Dazu braucht es mehrere Sprachen – Körper, Stimme, Schrift. Wenn nur Muskeln reden dürfen, schweigen viele. Vor jeder Session sollte ein kleines Gespräch stehen: Was brauchst du, damit dein Körper atmen kann, dein Geist nicht taumelt? So einfach, so selten.
Wir müssen Reize filtern, Neurodiversität mitdenken, Rückzugsorte schaffen, in denen das Licht weich ist und niemand drängt. Barrierefreiheit heißt Aufzüge, klare Schilder, Gebärdensprache, stabiles WLAN. Nichts davon Luxus, alles Basis. Erst darauf wachsen die Wünsche: ein Dark Mode für müde Augen, ein Joystick für die Tanzfläche. Dann kommt die Freude – Access Pleasure. Der Moment, in dem Zugänglichkeit nicht nur funktioniert, sondern lächelt.
Geht man weiter, beginnt Access Play. Man baut Rampen wie Spielzeug, erfindet neue Regeln, tauscht Rollen – wer hilft wem, wer wird gehalten? So wird Barrierefreiheit zum Experiment, körperliche Lust zum Labor. Bedürfnisse beenden Schmerz, Wünsche nähren Visionen, Freude belohnt den Weg, Spiel schreibt die Landkarte neu. Erst wenn all das zusammenklingt, leuchtet jeder Körper, auch meiner.
Sexuelle Lust ist die Blüte, Access Pleasure der Boden, aus dem sie wächst. Erst wenn Räume, Technik und Körper einander bedingungslos Zugang gewähren, öffnet sich das Spiel: Eine Rampe wird zur Einladung, ein Gebärden‑Dolmetscher zum Liebesbrief, ein Joystick zum vertrauten Requisit. Was als barrierefreies Detail begann, resoniert in jeder Berührung, jeder Bewegung; Access Play und erotisches Spiel klingen wie zwei Saiten, die im selben Akkord schwingen – und das Ergebnis ist ein einziger, ungetrennter Klang von Freude.
Weiter
Vielleicht sollten wir selbst ein Festival erfinden, eines, das Barrierefreiheit nicht als Rubrik führt, sondern als Duft, der überall haftet. Kein Schonraum für Behinderte, kein pädagogischer Zaun, sondern ein Markt der Fähigkeiten: Rampen neben Tanzflächen, Dolmetscher zwischen Bassboxen, Dialog und Schweiß in derselben Hitze. Diversität, Zustimmung, Kreativität – alle Körper, alle Sprachen, ein gemeinsames Spiel.
Ich suche Verbündete. Bis dahin fahre ich weiter zu sex-positiven Räumen und Festivals, die bereits existieren. Ich lerne dort, genieße, kritisiere. Ich warte auf den Tag, an dem Lust und Zugänglichkeit nicht mehr kollidieren, sondern wie zwei Ströme zusammenlaufen und aus dem gleichen Licht glänzen.